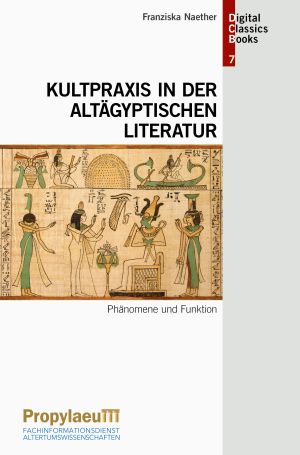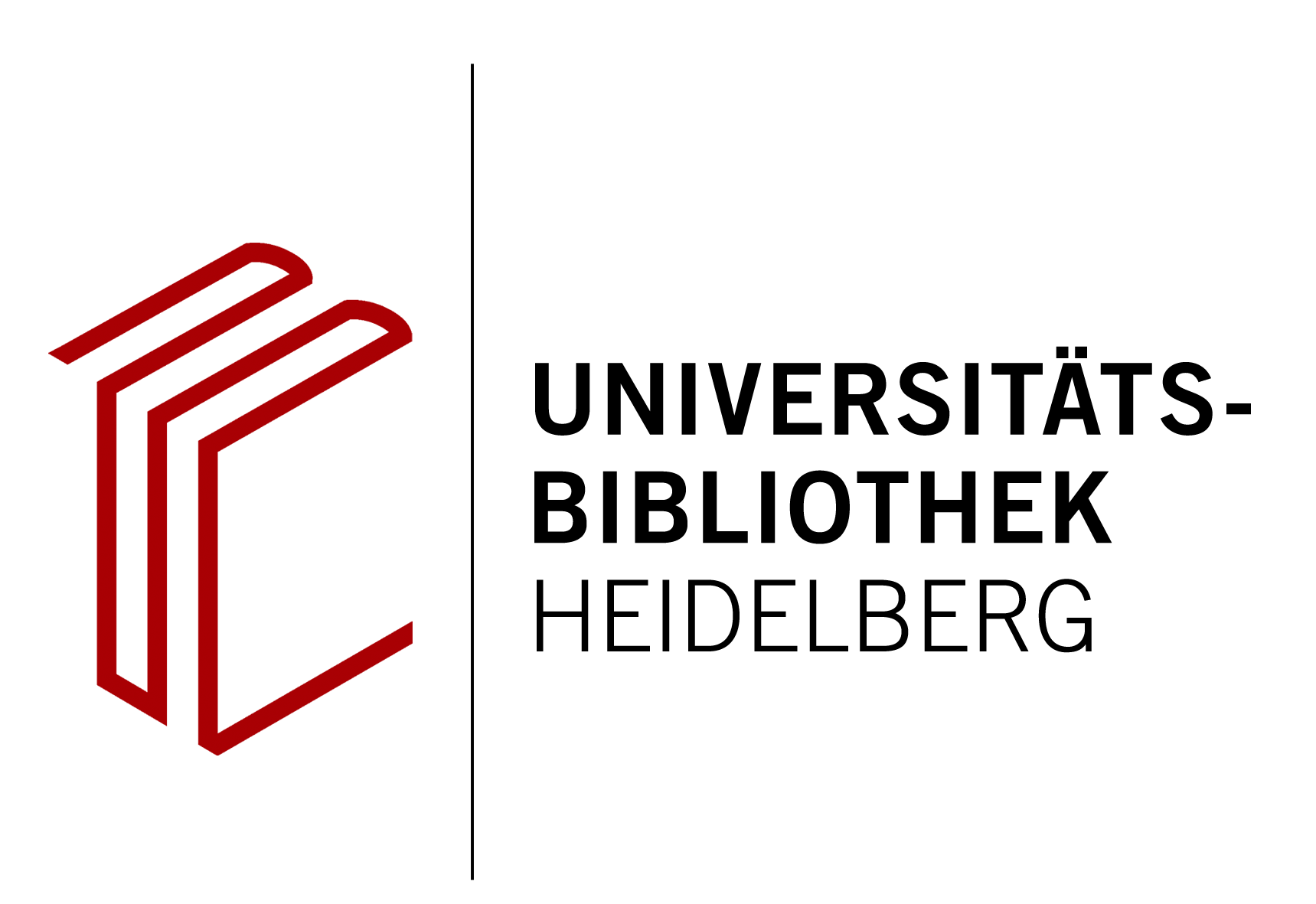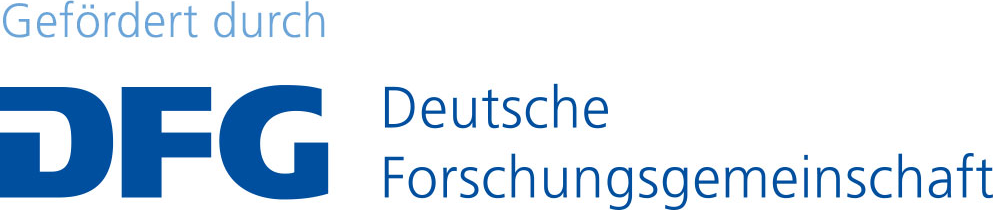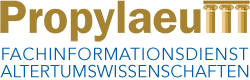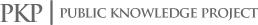Bücher
Römische Funde aus dem rechtsrheinischen Teil der Kreise Kleve und Wesel
Grundlage dieser Arbeit sind die römischen Funde von 208 Fundstellen aus den rechtsrheinischen Teilen der Kreise Kleve und Wesel am Niederrhein. Der Großteil der Funde wird hier erstmals vorgelegt.
Der Forschungsgeschichte folgt die Bearbeitung der vielen Funde, die von 60 v. Chr. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts datieren. Etliche Fundtypen waren bisher kaum oder gar nicht aus diesem Gebiet bekannt. Beschrieben werden die antiken Topographie und die Böden, die Besiedlungsgeschichte von der Späteisen- bis zur Merowingerzeit, die Archäologie und antike Quellen, die u. a. den Grad der römischen Kontrolle im Limesvorland und die Rolle des Rheins als Grenze des Römischen Reiches beleuchten.
Die Klosterkirche Corvey: Bauuntersuchung und Baugeschichte des Westbaus. Teil 1
Als ältestes Baudenkmal in Westfalen-Lippe hat der karolingische Westbau der Kirche St. Stephanus und Vitus des ehemaligen Abteiklosters Corvey herausragende Bedeutung für die historische Identität des Landes. Die 822 am Westufer der Weser errichtete Benediktinerabtei Corvey war eines der wichtigsten kulturellen und wirtschaftlichen Zentren zwischen Nordsee und Süddeutschland und stand in regem geistig-kulturellem Austausch mit anderen frühmittelalterlichen Bildungszentren Europas. Mit dem vorliegenden Band gelingt eine umfassende Darstellung der wechselvollen Baugeschichte des Westbaus, von den karolingischen Anfängen im 9. Jahrhundert über hochmittelalterliche Umbauten bis hin zu neuzeitlichen Eingriffen und Erweiterungen.
Die Klosterkirche Corvey: Bauuntersuchung und Baugeschichte des Westbaus. Teil 2
Als ältestes Baudenkmal in Westfalen-Lippe hat der karolingische Westbau der Kirche St. Stephanus und Vitus des ehemaligen Abteiklosters Corvey herausragende Bedeutung für die historische Identität des Landes. Die 822 am Westufer der Weser errichtete Benediktinerabtei Corvey war eines der wichtigsten kulturellen und wirtschaftlichen Zentren zwischen Nordsee und Süddeutschland und stand in regem geistig-kulturellem Austausch mit anderen frühmittelalterlichen Bildungszentren Europas. Mit dem vorliegenden Band gelingt eine umfassende Darstellung der wechselvollen Baugeschichte des Westbaus, von den karolingischen Anfängen im 9. Jahrhundert über hochmittelalterliche Umbauten bis hin zu neuzeitlichen Eingriffen und Erweiterungen.
Die Klosterkirche Corvey: Bauuntersuchung und Baugeschichte des Westbaus. Beilagen
Als ältestes Baudenkmal in Westfalen-Lippe hat der karolingische Westbau der Kirche St. Stephanus und Vitus des ehemaligen Abteiklosters Corvey herausragende Bedeutung für die historische Identität des Landes. Die 822 am Westufer der Weser errichtete Benediktinerabtei Corvey war eines der wichtigsten kulturellen und wirtschaftlichen Zentren zwischen Nordsee und Süddeutschland und stand in regem geistig-kulturellem Austausch mit anderen frühmittelalterlichen Bildungszentren Europas. Mit dem vorliegenden Band gelingt eine umfassende Darstellung der wechselvollen Baugeschichte des Westbaus, von den karolingischen Anfängen im 9. Jahrhundert über hochmittelalterliche Umbauten bis hin zu neuzeitlichen Eingriffen und Erweiterungen.
Ergebnisse zur archäologischen Abbruchbegleitung der ehemaligen Eternitfabrik im Bereich des augusteisch-tiberischen Truppenplatzes NOVAESIUM im Neusser Augustinusviertel
Neuss gehört zu den wenigen Orten in Deutschland, deren Wurzeln tief in der Antike liegen. Schon in den letzten beiden vorchristlichen Jahrzehnten befand sich hier an der Mündung der Erft in den Rhein eine stark befestigte Operationsbasis der römischen Streitkräfte. Dort führte das Pulheimer Fachbüro minerva X in den Jahren 2021 und 2022 auf dem ca. 7 ha großen Gelände der ehemaligen Eternitfabrik anlässlich des Abbruchs der Werkshallen eine archäologische Untersuchung durch. Wenngleich der Fundplatz als Teil des augusteisch-tiberischen Truppenplatzes NOVAESIUM seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt ist und hier über Jahrzehnte zahlreiche Maßnahmen stattfanden, bildet der derzeitige Publikationsstand nicht die Höhe der Forschung ab. Der vorliegende Bericht fasst den aktuellen Forschungsstand zusammen und gibt eine Übersicht der Befundlage im Westen der UNESCO-Welterbefläche.
Die Darstellung und Selbstdarstellung der kaiserlichen Familie im römischen Ägypten: Eine Untersuchung von Octavian-Augustus bis Hadrian (30 v. Chr.–138 n. Chr.)
Die Arbeit untersucht die Frage, welche Funktionen den Frauen und weiteren Mitgliedern der Kaiserfamilie für die Repräsentation des Kaiserhauses im römischen Ägypten zukamen. Aufgrund ihres seriellen Charakters stellen Münzen hierfür die beste Quellengruppe dar, sodass die alexandrinische Provinzialprägung im Zentrum steht und mit der römischen Reichsprägung verglichen wird, um provinzielle Eigenheiten sowie römische Einflüsse aufzudecken. Kontextualisiert wird dies durch weitere Quellen wie Papyri und Inschriften, um so ein möglichst umfassendes Bild der Darstellung, Selbstdarstellung und – wo möglich – der Wahrnehmung der kaiserlichen Familie in der Provinz zu gewinnen.
Theorie | Archäologie | Reflexion 2: Kontroversen und Ansätze im deutschsprachigen Diskurs
Der Doppelband „Theorie | Archäologie | Reflexion. Kontroversen und Ansätze im deutschsprachigen Diskurs“ widmet sich der Diversität an Zugängen, die den archäologischen Theoriediskurs heute und in naher Zukunft prägen. Dazu versammelt er wegweisende Beiträge, spannende Gedankenexperimente und erste theoretische Annäherungen quer durch das archäologische Fächerspektrum. Dabei kommen sowohl etablierte als auch Nachwuchswissenschaftler*innen zu Wort, um neue Impulse und Ansätze in den Diskurs einzuspeisen oder bestehende Zugänge zu diskutieren. Die Beiträge in Band 2 fokussieren auf Relationen und Beziehungen, Zeit und Raum sowie auf Modelle, Analogien und Abstraktionen in der Archäologie.
Zehn Jahre Monitoring an der Wattenheimer Brücke (Lorsch, Kreis Bergstraße): Ergebnisse und Trends
Diese einzigartige, über ein ganzes Jahrzehnt andauernde Monitoringstudie zu einem Beweidungsprojekt mit Rindern im südhessischen Lorsch, erlaubt tiefe Einblicke in die Veränderung der Artenvielfalt. Einzelstudien behandeln sowohl die Botanik als auch die Laufkäfer, Avifauna, Säugetiere, Amphibien, Reptilien aber auch Spinnen, Ameisen, Tagfalter und Wanzen sowie die Fischvielfalt im angrenzenden Gewässer Weschnitz. Das Werk zeigt eindrücklich den Einfluss großer Pflanzenfresser sowie die Veränderung des Artenspektrums durch Klimawandel auf.
Zugehörige Forschungsdaten: https://doi.org/10.11588/DATA/JAYMZQ
Der Karlsgraben und die Anfänge des Kanalbaus in Europa: Künstliche Wasserwege in Antike und Mittelalter. Teil 2: Katalog und Tafeln
Künstlich angelegte schiffbare Kanäle dienen der Optimierung natürlicher Wasserwege. In Europa liegen ihre Anfänge in Antike und Mittelalter. Eines der außergewöhnlichsten Bauvorhaben ist der Karlsgraben zur Verbindung von Rhein und Donau, der in die Jahre 792/793 n. Chr. datiert. Das Buch präsentiert ausgehend von Quellen und Methoden der Archäologie, Geschichts- und Geowissenschaften neue Ergebnisse zur Konstruktion, Baustellenorganisation und Chronologie sowie zu den historisch-politischen Rahmenbedingungen. Der Karlsgraben wird anschließend in die Entwicklung des frühen Kanalbaus eingeordnet. Die Grundlage bildet eine diachrone Analyse von über 200 archäologisch und historisch überlieferten Kanalbauten von der Antike bis zum Spätmittelalter zwischen Nordengland und dem Eisernem Tor.
Beast and Human: Case Studies for Northern Europe from Prehistoric to Early Modern Times
Aus guten Gründen gibt es mehr und mehr Untersuchungen zu Tier und Mensch („Human-Animal Studies“) in der Archäo(zoo)logie, die einen Perspektivwechsel versuchen – es ist Zeit, die Rolle der Menschen im Umgang mit Tieren differenzierter zu sehen und vor allem den Tieren eine größere Eigenart beizumessen. Mit einigen Änderungen geht die vorliegende Publikation auf eine Veranstaltung während des Jahrestreffens der Europäischen Vereinigung der Archäolog*innen (EAA) im September 2021 in Kiel zurück. Auf der Grundlage der zwölf Artikel kann eine Erzählung präsentiert werden, die geographisch von England bis nach Russland und zeitlich von der Steinzeit bis zur Frühen Neuzeit reicht.
Der Karlsgraben und die Anfänge des Kanalbaus in Europa: Künstliche Wasserwege in Antike und Mittelalter. Teil 1: Text
Künstlich angelegte schiffbare Kanäle dienen der Optimierung natürlicher Wasserwege. In Europa liegen ihre Anfänge in Antike und Mittelalter. Eines der außergewöhnlichsten Bauvorhaben ist der Karlsgraben zur Verbindung von Rhein und Donau, der in die Jahre 792/793 n. Chr. datiert. Das Buch präsentiert ausgehend von Quellen und Methoden der Archäologie, Geschichts- und Geowissenschaften neue Ergebnisse zur Konstruktion, Baustellenorganisation und Chronologie sowie zu den historisch-politischen Rahmenbedingungen. Der Karlsgraben wird anschließend in die Entwicklung des frühen Kanalbaus eingeordnet. Die Grundlage bildet eine diachrone Analyse von über 200 archäologisch und historisch überlieferten Kanalbauten von der Antike bis zum Spätmittelalter zwischen Nordengland und dem Eisernem Tor.
H «Πυξίδα του Μουσαίου» από το Κυνόσαργες: Ένα νέο έργο του Ζωγράφου της Ερέτριας
In dieser Monographie wird ein bedeutender Neufund der attischen Vasenmalerei veröffentlicht. Es handelt sich um eine rotfigurige Pyxis vom Typ A aus den Jahren 430-425 v. Chr., die in einer Opferrinne auf dem Athener Kynosarges-Friedhof gefunden wurde. Die Vase trägt eine hervorragend erhaltene Darstellung des Barden Mousaios und der Neun Musen. Alle zehn Figuren sind durch aufgemalte Inschriften gekennzeichnet. Die Vase lässt sich durch eine erschöpfende Analyse als ein Werk aus der Zeit des Höhepunkts des Eretria-Malers bestimmen.
Demokratie- und Werteerziehung im Lateinunterricht
Das antike Rom war nie eine Demokratie, und die römische Gesellschaft unterschied sich in ihren Werten von der heutigen fundamental. Doch lassen sich die Ziele von Demokratie- und Werteerziehung dennoch im Lateinunterricht erreichen. Der Band versammelt dazu fünf Beiträge ausgewiesener Expertinnen und Experten des Fachs an der Schnittstelle zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik. Er zeigt beispielhaft auf, welche Texte und Konzepte geeignet sind, um dieses Ziel zu erreichen. Die vorgestellten Beispiele betreffen die klassische Geschichtsschreibung (Livius), die kaiserzeitliche Briefliteratur (Plinius d. J.), schließlich utopische Literatur der frühen Neuzeit. Zudem wird ein Überblick über den Bereich der politischen Bildung im Lateinunterricht gegeben.
A Paleography of the Book of Kemyt
Das Buch Kemyt ist ein altägyptischer Schultext, der auf Tonscherben, Papyri, Schreibtafeln, Wänden und hunderten von Ostraka über einen Zeitraum von sechs Jahrhunderten überliefert ist. Die verwendete Handschrift stellt eine Besonderheit neben den üblichen Schriftarten des Hieratischen und der Kursivhieroglyphen dar. Der vorliegende Band präsentiert erstmals das gesamte Zeicheninventar von mehr als 200 Quellen, das unter anderem mithilfe digitaler Methoden erstellt wurde. Diese erste Paläographie des Buches Kemyt ermöglicht nun eine synchrone und diachrone Perspektive sowie überregionale Vergleiche. Die PDF-Version ist zudem mit der Online-Datenbank für Hieratisch und Kursivhieroglyphen „AKU-PAL“ verknüpft.
Frankish Seats of Power and the North: Centres Between Diplomacy and Confrontation, Transfer of Knowledge and Economy
Herrschaftssitze des Mittelalters standen im Zentrum des diplomatischen Austauschs und der Konfrontation, prägten den Wissenstransfer und fungierten als Kontrollzentren der Wirtschaft. Dies galt für Aachen und Ingelheim, die für das Fränkische Imperium stehen, aber auch für Haithabu als dem für Nordeuropa herausragenden Platz. Die Beiträge in diesem Buch bringen Machtzentren und Funde aus dem Fränkischen Reich und dem Norden im Zeitraum von der Spätantike (4./5. Jh.) bis zum Hohen Mittelalter (10. bis 12. Jh.) zusammen, und sie kommen zu neuen und manchmal überraschenden Erkenntnissen. Das Buch beruht auf einer Tagung in Aachen (8.-11. November 2022).
PIA 2: Bericht des Pilotprojekts Inwertsetzung Ausgrabungen
Das „Pilotprojekt Inwertsetzung Ausgrabungen“ (PIA) entwickelt seit 2023 Methoden und Standards für die effiziente Aufbereitung der stetig steigenden Zahl an Rettungsgrabungen.
Den Schwerpunkt des zweiten PIA-Bandes bildet der große frühmittelalterliche Bestattungsplatz von Heilbronn-Sontheim. Am selben Ort kamen auch Gräber und Siedlungsmaterial der Latènezeit zutage, die ebenfalls in diesem Band vorgelegt werden. Weitere Beiträge befassen sich mit Siedlungsbefunden der späten Urnenfelderzeit aus Mühlacker im Enzkreis, römerzeitlichen Funden und Befunden aus Cleebronn (Lkr. Heilbronn) und merowingerzeitlichen Gräbern aus Heilbronn-Neckargartach. Ein Überblick zu den Rettungsgrabungen des Jahres 2024 rundet den Band ab.
Zugehörige Forschungsdaten: https://doi.org/10.11588/DATA/CEWIVZ
Approaching the Koumasa Settlement as a Case of Dynamic Topography: Internal Functionality and its Role as a Focal Point in the Messara-Asterousia Region
Obwohl die minoische Stätte Koumasa im Süden Kretas seit über einem Jahrhundert eine prominente Rolle in der Forschung spielt, wurde ihre topographische und regionale Bedeutung weniger untersucht. Die Analyse der Topographie in und um Koumasa bietet sowohl eine Grundlage für zukünftige Kontextstudien als auch eine holistische und diachrone Betrachtung der Netzwerke in der Zentral-Messara und der Asterousia-Region, an deren Übergang Koumasa liegt. Die innovative Anwendung von GIS-Methoden in Kombination mit Geländebegehungen liefert neue Erkenntnisse einerseits zur Methodologie und andererseits zur Bedeutung Koumasas in minoischer Zeit und ihrem darauffolgenden allmählichen Niedergang.
Castra et Villae in der Spätantike: Fallbeispiele von Pannonien bis zum Schwarzen Meer
In acht Studien werden neue Forschungsergebnisse zur spätantiken Militär- und Villenanlagen (3.-7. Jh. n. Chr.) von Pannonien bis zum Schwarzen Meer vorgelegt. Sie richten den Blick über die Donauprovinzen hinaus nach Westen bis an den Oberrhein und nach Süden bis zum Zentralbalkan. Die Beispiele belegen die Bedeutung landschaftsarchäologischer Betrachtungen für die Rekonstruktion der mikro- und makroregionalen Einbindung einzelner Anlagen und zeigen, wie sich hieraus neue aufschlussreiche Hinweise bezüglich ihrer funktionalen Bedeutung ergeben.
Die Klosterkirche Corvey: Geschichte und Archäologie
Die Abteikirche des Reichsklosters Corvey im Weserbogen bei Höxter blickt auf eine mehr als 1.000-jährige Geschichte zurück. Das Westwerk ist der einzige vollständig erhaltene karolingische Bau dieser Art und ein Unikat in der karolingischen Baukunst. Ein Umbau in der Zeit der Romanik verlieh dem Westbau seine heute noch erhaltene, von zwei schlanken romanischen Türmen bekrönte Westfassade. Aufgrund der einzigartigen, komplexen Binnenstruktur des Westwerks und der Qualität seiner Ausstattung wurde das Ensemble in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen.
In diesem Band werden die Ergebnisse der 40-jährigen archäologischen Erforschung der ehemaligen Benediktinerabtei Corvey vorgestellt. Nach einer Einführung in die Historie des Klosters werden die Befunde und Funde präsentiert und die Skelettfunde aus der Kirche anthropologisch bearbeitet.
Vom Dübelstein zur Waldmannsburg: Adelssitz, Gedächtnisort und Forschungsobjekt
Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes des Vereins Pro Waldmannsburg und der Kantonsarchäologie Zürich ist in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Landesmuseum ein umfassendes Werk zu Geschichte und Archäologie der Burg Dübelstein entstanden.
Im Zentrum der Publikation steht die Auswertung der Ausgrabungen von 1942/43, welche der Historiker und Archäologe Hans Erb im Auftrag der Stadt Zürich durchgeführt hatte. Anhand der Baureste und des reichhaltigen Fundmaterials sowie der schriftlichen Quellen und Bilddokumente kann die Geschichte der Burg sowie ihrer Bewohnerinnen und Bewohner von den Anfängen im 13. Jh. bis zum Untergang im Brand von 1611 nachgezeichnet werden.
Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf den berühmtesten Besitzer gerichtet, auf den Zürcher Bürgermeister, Kriegshelden und Haudegen Hans Waldmann, dem die Burg von 1487 bis zu seinem Tod 1489 gehörte. In diesem Zusammenhang ist auch die Funktion als Gedächtnisort von Interesse, welche die Burgstelle nach dem 400. Todesjahr Waldmanns 1889 gewonnen hatte.
Burgen in Appenzell: Ein historischer Überblick und Berichte zu den archäologischen Ausgrabungen auf Schönenbüel und Clanx
Die Anfänge der Besiedlung in der Landschaft Appenzell reichen wohl bis ins 7./8. Jh. zurück. Frühe schriftliche Belege konzentrieren sich zuerst auf das Hinterland (im 9. Jh. nachweislich bewohnt) und betreffen in der Zeit des hochmittelalterlichen Landesausbaus auch den Talkessel von Appenzell (1071 Ausstattung der Kirche); das Mittel- und das Vorderland sind erst in jüngerer Zeit urkundlich belegt.
Die im Jahr 2001 archäologisch untersuchte Burganlage Schönenbüel, der mutmassliche Sitz der urkundlich belegten Herren von Schönenbüel, liegt auf dem Hirschberg östlich von Appenzell. Die kreisrunde «Holz-Erdburg» hatte einen Gesamtdurchmesser von rund 60 m. Unter der Wallschüttung gab es neben einem vermuteten Brandrodungshorizont aus der Zeit zwischen dem 9. und 11. Jh. eindeutige Reste einer ersten Besiedlung im 11. Jh. Im Verlaufe des 12. Jh. wurde die kreisrunde Wehranlage gebaut.
Die Burgruine Clanx liegt nördlich des Hauptortes Appenzell auf einem steilen Bergkegel. Die Forschung geht davon aus, dass die Herren von Sax die Burganlage zwischen 1207 und 1220 errichten liessen. Nach Aussage von Chronisten wurde die Burg 1289 belagert und gebrochen. Nach erfolgtem Wiederaufbau wurde sie 1402 als Auftakt zu den Appenzeller Kriegen durch die Appenzeller erneut zerstört. Clanx blieb Ruine und wurde zum Symbol des Appenzeller Unabhängigkeitsstrebens.
1944 und 1949 wurde Clanx teilweise ausgegraben und konserviert. Die unausgewerteten Funde und Befunde wurden im Zuge eines Nationalfondsprojektes bearbeitet. Teile des zur Hauptsache aus Geschirrkeramik, Ofenkeramik und Metall bestehenden Fundmaterials konnten dem Zerstörungshorizont von 1402 zugewiesen werden und bilden eine wichtige Grundlage zum Aufbau einer mittelalterlichen Keramiktypologie in der Ostschweiz.
Digitale Methoden des Lernens und Lehrens in der Archäologie: Chancen und Herausforderungen
Data Literacy hat in den vergangenen Jahren in den archäologischen Disziplinen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Während in der Forschung schon lange mit digitalen Werkzeugen gearbeitet wird, sind in der Lehre sowohl die Vermittlung digitaler Kompetenzen als auch die Anwendung digitaler Lehrformate bislang eher noch die Ausnahme. Das Netzwerk „Digitale Kompetenzen in der Archäologie“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, hier für Verbesserung zu sorgen. Auf einem Workshop an der TU Darmstadt im Juni 2024 wurden Chancen und Herausforderungen digitaler Methoden des Lernens und Lehrens angeregt diskutiert und zahlreiche Best Practice-Beispiele vorgestellt. Die Ergebnisse dieses Workshops werden in dem hier vorliegenden Band präsentiert. Sie bieten wertvolle Anregungen für die zukünftige Entwicklung digitaler Lehrkonzepte in der Archäologie.
Kultpraxis in der altägyptischen Literatur: Phänomene und Funktion
Aus dem Alten Ägypten sind zahlreiche Kultpraktiken belegt – von Begegnungen der Menschen mit Gottheiten, Dämonen und Toten bis hin zu Prozessionen, Orakeln und magischen Praktiken. Diese Kultpraktiken werden auch in literarischen Texten erwähnt – vom Mittleren Reich (ab ca. 2137 v. Chr.) bis in die Römerzeit (bis ins 3. Jh. n. Chr.) – in Mittelägyptisch, Neuägyptisch und Demotisch. In diesem Band werden folgende Aspekte diskutiert: die Präsentation des Göttlichen; Konzeptionen göttlicher und sakraler Gerechtigkeit; Erscheinungsformen des Schicksals und Zukunftsperspektiven; Selbstreflexionen über die Kultpraxis inklusive Zweifel; und das Ungesagte und „Geheimwissen“. Ein kulturübergreifender Ausblick auf die Forschung zu anderen antiken Literaturen schließt den Band ab.
Kultpraxis in der altägyptischen Literatur: Phänomene und Funktionen
Aus dem Alten Ägypten sind zahlreiche Kultpraktiken belegt – von Begegnungen der Menschen mit Gottheiten, Dämonen und Toten bis hin zu Prozessionen, Orakeln und magischen Praktiken. Diese Kultpraktiken werden auch in literarischen Texten erwähnt – vom Mittleren Reich (ab ca. 2137 v. Chr.) bis in die Römerzeit (bis ins 3. Jh. n. Chr.) – in Mittelägyptisch, Neuägyptisch und Demotisch. In diesem Buch werden erstmals alle Passagen aus ca. 200 narrativen, instruktiven und diskursiven literarischen Werken in ihrer Gesamtheit analysiert. Mit einer zweigleisigen Methodik aus Religions- und Literaturwissenschaft werden Setting und Inhalt der Quellen im Detail besprochen.
Siedlungsdynamik in den Becken von Sykourio und Elateia, Nordost-Thessalien, in prähistorischer Zeit: Ergebnisse der archäologischen, geomorphologischen und geophysikalischen Untersuchungen
In zwölf Hauptkapiteln widmet sich ein Team von 19 Autoren und Autorinnen Fragen zur Siedlungsdynamik in einem klar definierten geographischen Gebiet zwischen Olymp und Ossa in Nordost-Thessalien. Mithilfe von systematischen Oberflächenbegehungen und anderen, ausschließlich non-invasiven Methoden, die sie in einem Geographischen Informationssystem auswerten, untersuchen sie die Landschaft, die Siedlungsmuster, die materielle Kultur sowie die relative und absolute Chronologie in prähistorischer Zeit. Die gewonnenen Erkenntnisse und bisher unerforschte archäologische Funde werfen ein neues Licht auf das Neolithikum und Chalkolithikum in den Becken von Sykourio und Elateia.