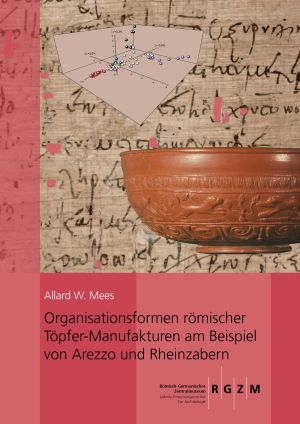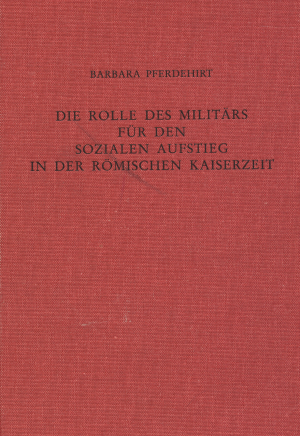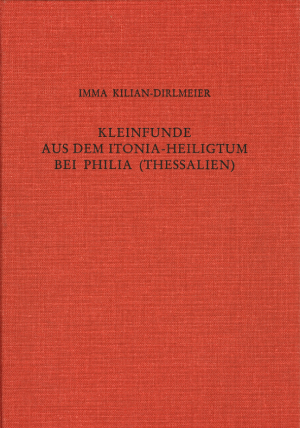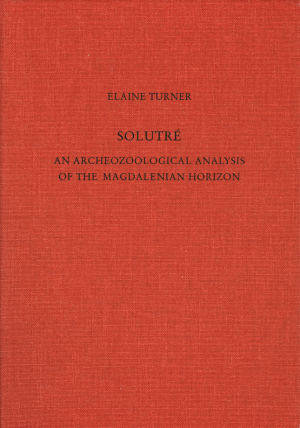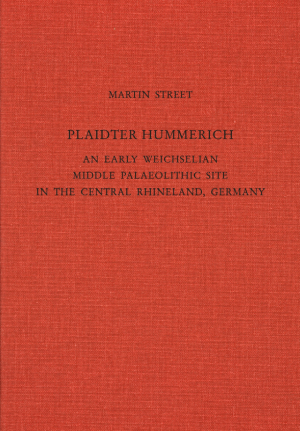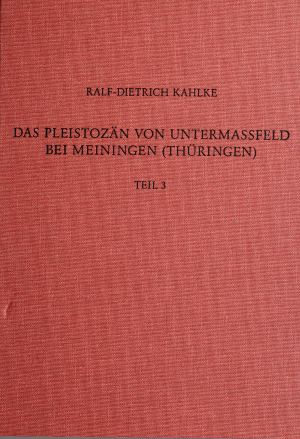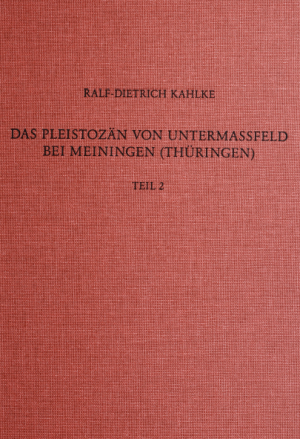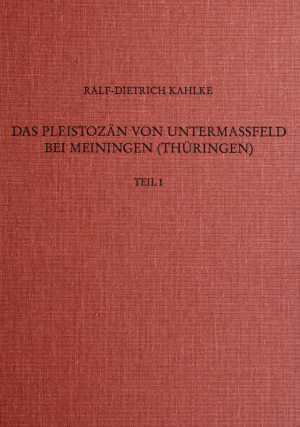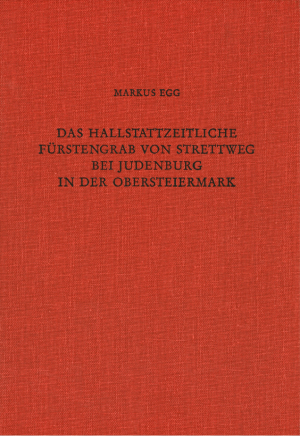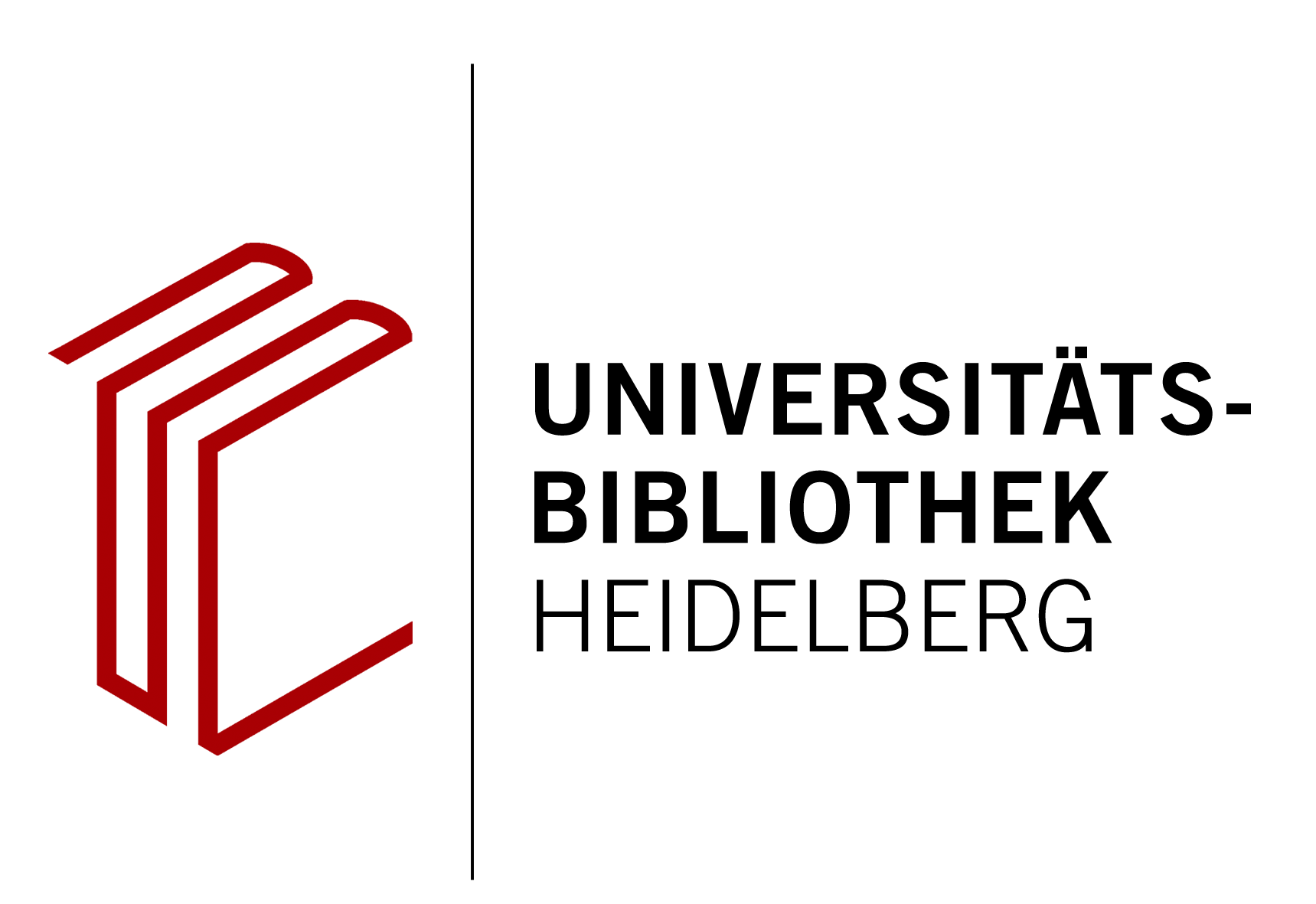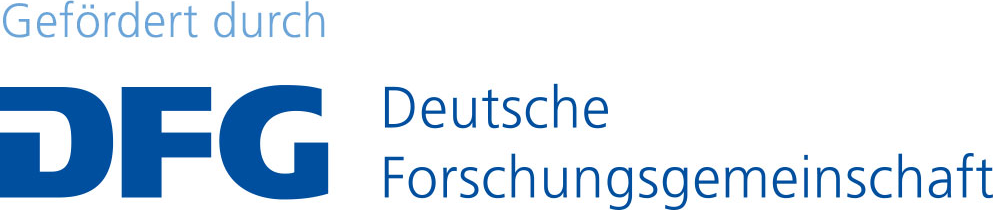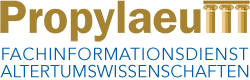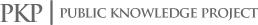Monographien des RGZM
In der Monographien-Serie des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, werden auf der Grundlage archäologischer, historischer und literarischer Quellen übergreifende Fragestellungen zur prähistorischen, antiken und frühmittelalterlichen Geschichte, Kultur und Kunst behandelt. Ergänzende Materialien und Open Data können in die Online-Version aufgenommen werden.
Das Online-Angebot soll kontinuierlich durch die Retrodigitalisierung älterer Bände ergänzt werden.
Zusatzdaten zu Publikationen dieser Reihe
Italienische Übersetzung der Texte aus:
Joachim Weidig, Bazzano – ein Gräberfeld bei L’Aquila (Abruzzen). Die Bestattungen des 8.–5. Jahrhunderts v.Chr., Monographien des RGZM, Band 112 (Mainz 2014)
Weitere Publikationen des Römisch-Germanischen Zentralmuseums

Verlag
Leibniz-Zentrum für Archäologie
Ludwig-Lindenschmit-Forum 1
D-55116 Mainz
Tel.: +49 6131 8885 0
E-mail: verlag@rgzm.de
Bisher erschienen
Organisationsformen römischer Töpfer-Manufakturen am Beispiel von Arezzo und Rheinzabern unter Berücksichtigung von Papyri, Inschriften und Rechtsquellen
Die römische Terra Sigillata wurde mit anspruchsvoller Technologie in großen Manufakturen hergestellt. Die rot engobierte Feinkeramik wurde über das gesamte römische Imperium vermarktet. Die komplexen Organisationsformen in den Produktionszentren und das Verbreitungsnetzwerk waren bisher kaum erforscht. Dieses Buch erörtert die Sozial- und Arbeitsorganisationsstrukturen innerhalb der Produktionszentren vom 1. Jh. v. Chr. bis zum 3. Jh. n. Chr. mit einem doppelten Ansatz: Erstens werden die Figurenstempel-Kombinationen auf reliefverzierter Terra Sigillata analysiert, und zweitens werden die Resultate mit den fast 40 bekannten ägyptischen Papyri mit Töpferverträgen verglichen. Darüber hinaus werden die feststellbaren Cluster der Töpfer auf ihr Wiederkehren in den Verbreitungsmustern hin erforscht. Die Konsortium-Gruppen werden mithilfe ihres Vorkommens an datierten Plätzen zeitlich eingeordnet. Die soziale Analyse der Töpferstempel zeigt, dass Sklaven in der Terra Sigillata-Industrie nicht nachgewiesen werden können.
Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in der römischen Kaiserzeit
Um im römischen Reich wichtige Ämter in Politik, Verwaltung und Militär übernehmen zu können war das römische Bürgerrecht unabdingbar. Peregrine Männer, die sich für den Militärdienst verpflichteten, erhielten nach Ablauf ihrer Dienstzeit und ehrenhafter Entlassung das römische Bürgerrecht für sich und ihre Kinder sowie das Recht mit einer Nichtrömerin eine rechtmäßige Ehe zu führen. Im vorliegenden Buch wird auf der Grundlage von sog. Militärdiplomen untersucht, wie sich diese Privilegien bei den verschiedenen Truppengattungen im Laufe der Zeit veränderten und welche Auswirkungen sich dabei für die Nachkommen der Soldaten ergaben.
Kleinfunde aus dem Itonia-Heilgtum bei Philia (Thessalien)
Steinstelen mit Inschriften des thessalischen Koinon sichern die Lokalisierung des Itonia-Heilgtums, des Stammenheiligtums der Thessaler, beim Dorf Philia, Nomos Karditsa (Thessalien). Ab 1960 wurde das Areal des Heiligtums durch Tiefpflügen bis zum gewachsenen Boden aufgerissen und von Raubgräbern intensiv geplündert. Teile der Ausbeute sind in europäische und amerikanische Museen gelangt. Bei den systematischen Rettungsgrabungen 1963-67 konnte D. Theocharis nur noch geringe Reste von Stratigraphie und ungestörten Befunden dokumentieren. Die Bearbeitung der Kleinfunde konzentriert sich deshalb auf die chrono-typologische Bestimmung. Weiter werden die Funktionen – Votiv, Kultgerät, Werkzeug u.ä. – behandelt sowie die Frage nach dem Personenkreis der Besucher gestellt. Aussagen zum diachronen Verlauf des Kultbetriebs können sich auf die Funde und auf die literarische Überlieferung stützen.
Solutré: An archeozoological analysis of the Magdalenian horizon
In dieser Monographie werden die Ergebnisse einer Analyse der Fauna des magdalénischen Horizonts von Solutré, Burgund, Frankreich, vorgestellt. Sie zeigen, dass die Magdalener in Solutré hauptsächlich Pferde jagten, aber auch relativ viele Rentiere und Bisons erbeuteten. Die Todeszeitpunkte von Pferden, Rentieren und Bisons deuten darauf hin, dass der Ort wahrscheinlich zu unterschiedlichen Jahreszeiten genutzt wurde und dass Gruppen junger Rentiere und Bisons saisonal erlegt wurden. Eines der charakteristischen Merkmale der magdalénischen Faunengruppe ist die äußerst geringe Anzahl von Schlachtspuren und die große Anzahl von Nagespuren von Fleischfressern an den Überresten von Pferden, Rentieren und Bisons.
Plaidter Hummerich: an early Weichselian Middle Palaeolithic site in the Central Rhineland Germany
Der mittelpaläolithische Fundplatz Plaidter Hummerich lag auf dem Gipfel des namengebenden heute fast ganz abgebauten Osteifel-Vulkanes. Angrenzend im Osten ist die flache Landschaft des Neuwieder Beckens sowie das Rheintal. Ausgrabungen 1983-1986 der mehrschichtigen eiszeitlichen Ablagerungen der Kraterfüllung bargen etwa 3,000 Einzelfunde von Tierresten sowie 2,000 Funde aus lithischen Materialien. Letztere geben Einsicht in das technologische Können der Neandertaler, die verwendeten Gesteine weisen auf eine weiträumige Mobilität. Die Reste von überwiegend großen Pflanzenfressern – Wildrind, Pferd, Rothirsch – belegen das reichlich vorhandene Wildvorkommen als verfügbare Nahrungsbasis.
Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen (Thüringen)
Teil 3 der Monographie enthält die Bearbeitungen des spektakulären Feliden-Materials von Untermaßfeld, das Jaguar, Gepard, Puma, Luchs sowie Dolch- und Säbelzahnkatze umfasst. In dem reich illustrierten Band sind Untersuchungsergebnisse zu Insektenfressern, Hasenartigen und Nagetieren, Studien zu Herbivoren-Osteophagie und zu Kleinsäuger-Nagespuren sowie Ergebnisse von Paläotemperatur-Bestimmungen enthalten. Es schließt sich eine umfangreiche Darstellung der Entstehungsgeschichte des Fossilvorkommens sowie der Paläoökologie und Biostratigraphie des Frühpleistozäns von Untermaßfeld an. Beigegeben sind 15 Grabungspläne zur Dokumentation der über mehr als zwei Jahrzehnte geführten Grabungsarbeiten. Die Beiträge sind in deutscher oder englischer Sprache verfasst, sie verfügen jeweils über eine ausführliche englische Zusammenfassung.
Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen (Thüringen)
In Fortsetzung des 1997 erschienenen Teils 1 der Monographie werden in Teil 2 neue Forschungsergebnisse einer internationalen Arbeitsgruppe (Koordination R.-D. Kahlke) zur frühpleistozänen Fossilfundstelle Untermaßfeld behandelt. Der Band beinhaltet die Forschungsgeschichte 1989 bis 1996 sowie Abhandlungen zum geologischen Bau des Vorkommens sowie zur Entstehung der ungewöhnlichen Anreichung von Skelettresten, zur Methodik der osteologischen Präparation und Konservierung, zu Cerviden-Neufunden und Hippopotamus-Schädelresten, außerdem die Bearbeitungen des Gesamtmaterials der Rhinocerotiden, Equiden, Elephantiden, Caniden,
Ursiden, Musteliden und Hyaeniden sowie entsprechender Funde von Koprolithen. Die wiederum reich bebilderten Beiträge sind in deutscher oder englischer Sprache verfasst, sie verfügen jeweils über eine ausführliche englische Zusammenfassung.
Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen (Thüringen)
Die überaus fundreiche frühpleistozäne Wirbeltierlagerstätte Untermaßfeld wurde von einer weit gefächerten internationalen Arbeitsgruppe (Koordination R.-D. Kahlke) geowissenschaftlich und paläontologisch untersucht. Teil 1 der mehrteiligen monographischen Bearbeitung behandelt die Geschichte der Erforschung des Fossilvorkommens und seiner Umgebung sowie Beiträge zur Geologie und Paläomagnetik der Fundstelle selbst, zur Mollusken-Fauna und zu den aufgefundenen Resten von Fischen, Amphibien, Schildkröten und Vögeln. Behandelt werden zudem überaus reiche Funde von Boviden, Cerviden, Flusspferden und Wildschweinen. Der Gesamtbefund der Grabungsergebnisse (Geologie, Paläozoologie, Taphonomie, Paläoökologie, Stratigraphie) rundet die Darstellung ab. Die sämtlich reich illustrierten Beiträge sind in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfasst, sie verfügen jeweils über eine ausführliche englische Zusammenfassung.
Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark
Strettweg in der Obersteiermark war 1851/52 Schauplatz einer der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen Österreichs. Das reich ausgestattete Prunkgrab aus der Eisenzeit (um 600 v. Chr.) enthielt neben vielen anderen Gegenständen den berühmten "Kultwagen" – ein einzigartiges Meisterwerk hallstattzeitlichen Kunsthandwerks.
Die reichen Metallbeigaben sind Waffen, Pferdegeschirr- und Wagenteile, Bronze- und Tongefäße – also klassische Prestigegüter hallstattzeitlicher Eliten. Grabbeigaben der weiblichen Tracht lassen auf Totenopfer schließen. Weitreichende Kulturkontakte in die Hallstatt-Kulturen nördlich der Alpen, nach Oberitalien sowie in die antike Welt lassen sich nachweisen.
Italische Helme
Am Beispiel der italischen Helme lassen sich das Einflussgebiet der Etrusker im Picenum, in Oberitalien und im Alpenraum sowie die Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Kulturgruppen nachzeichnen.
Die Etrusker entwickelten im 7. Jh. v.Chr. den Helmtyp mit umlaufender Krempe; im Lauf des 6. Jhs. kam eine Kehle zur Befestigung des Kamms hinzu. Typisch für die archaische Stufe war der Negauer Helm. Er verschwand in Mittelitalien im 4. Jh., blieb aber im Alpenraum bis ins 1. Jh. v.Chr. in Gebrauch. Im Tiroler Raum und in der Ostschweiz fanden sich die Helme nicht wie sonst üblich als Prestigegüter in Gräbern, sondern in Opferplätzen, oft durch Feuer stark beschädigt. Ähnlich wie in Griechenland waren solche im Krieg erbeuteten Helme eine hochwertige Weihegabe.
Band 2, siehe.
Italische Helme
Am Beispiel der italischen Helme lassen sich das Einflussgebiet der Etrusker im Picenum, in Oberitalien und im Alpenraum sowie die Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Kulturgruppen nachzeichnen.
Die Etrusker entwickelten im 7. Jh. v.Chr. den Helmtyp mit umlaufender Krempe; im Lauf des 6. Jhs. kam eine Kehle zur Befestigung des Kamms hinzu. Typisch für die archaische Stufe war der Negauer Helm. Er verschwand in Mittelitalien im 4. Jh., blieb aber im Alpenraum bis ins 1. Jh. v.Chr. in Gebrauch. Im Tiroler Raum und in der Ostschweiz fanden sich die Helme nicht wie sonst üblich als Prestigegüter in Gräbern, sondern in Opferplätzen, oft durch Feuer stark beschädigt. Ähnlich wie in Griechenland waren solche im Krieg erbeuteten Helme eine hochwertige Weihegabe.
Band 1, siehe.