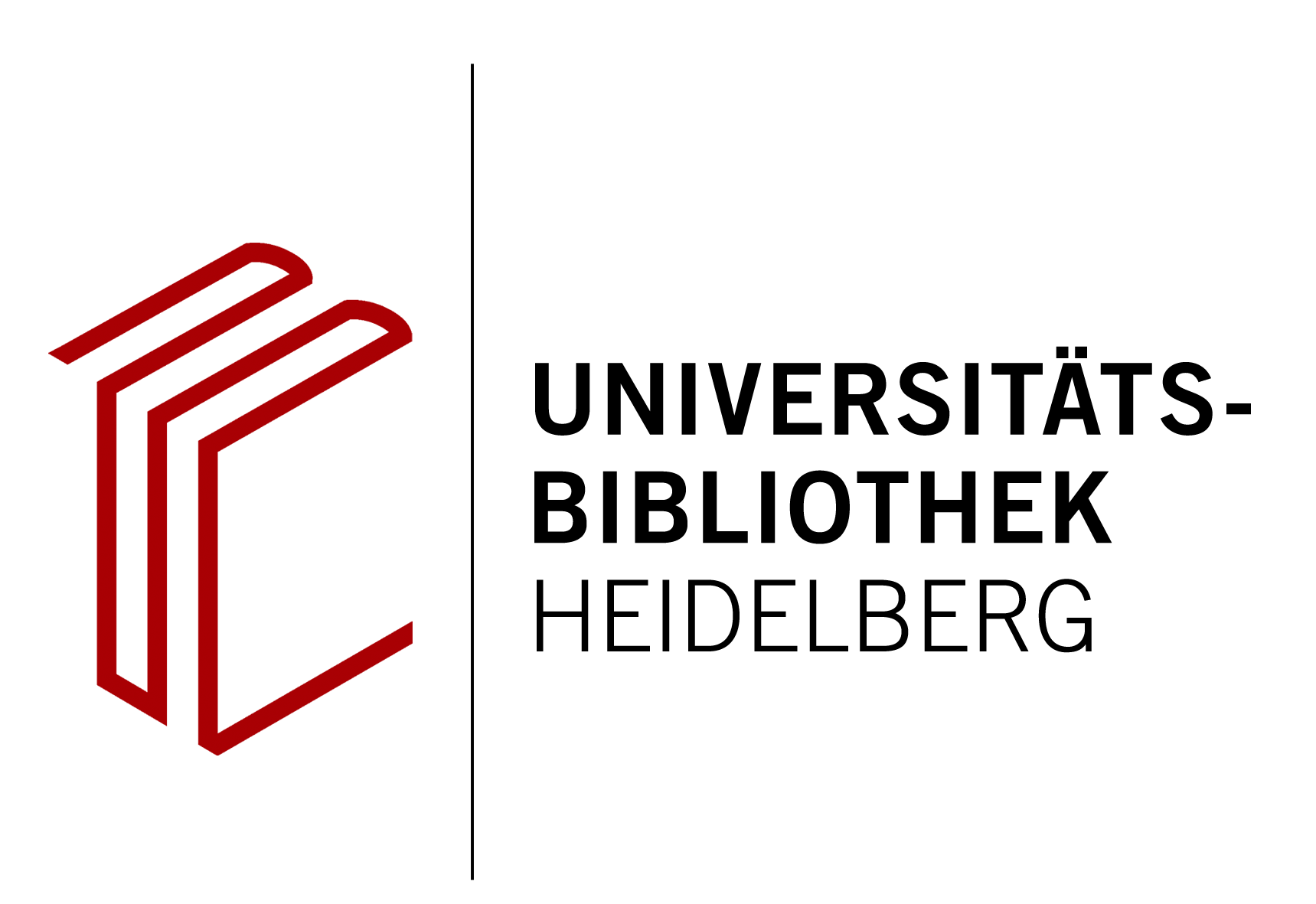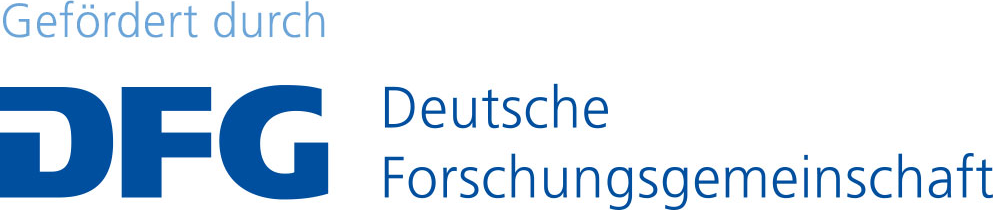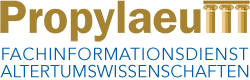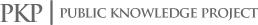Castellum Pannonicum Pelsonense
Die wissenschaftliche Publikationsreihe Castellum Pannonicum Pelsonense wurde 2010 mit dem Ziel gegründet die Ergebnisse der über 100 Jahre andauernden, archäologischen Forschungen am Fundplatz von Keszthely-Fenékpuszta und in seiner Umgebung – vom Balaton-Einzugsgebiet bis hin nach Südwestungarn – zu veröffentlichen. Neben Befunden und Funden der hier lokalisierten, spätantiken Befestigung werden Gräber- und Gräberfelder bearbeitet und landschaftsarchäologische Analysen ausgewertet. Der zeitliche Hauptfokus der Publikationsreihe liegt somit zwischen dem 4. und 9. nachchristlichen Jahrhundert. In diesem chronologischen Rahmen werden einschlägige Themen, wie römische Kontinuität, frühes Christentum und Etablierung frühmittelalterlichen gentes bearbeitet, die die Einbindung dieses Fundortes in die internationale Forschung – die Transformation der römischen Welt betreffend – aufzeichnen. Darüber hinaus werden archäologische Studien zur Vorgeschichte und zum Mittelalter vorgelegt, um die historische Entwicklung in der Untersuchungsregion abzubilden.
Die Reihe wird ab 2025 (ab Band 9) durch einen wissenschaftlichen Beirat betreut.

Die herausgebenden Institutionen:
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Leipzig
HUN-REN Research Center for the Humanities, Institute of Archaeology, Budapest
Balatoni Múzeum, Keszthely
Die wissenschaftliche Leitung der Reihe unterliegt:
Prof. Dr. Orsolya Heinrich-Tamáska
E-Mail: orsolya.heinrich-tamaska@
Bisher erschienen
Castra et Villae in der Spätantike: Fallbeispiele von Pannonien bis zum Schwarzen Meer
In acht Studien werden neue Forschungsergebnisse zur spätantiken Militär- und Villenanlagen (3.-7. Jh. n. Chr.) von Pannonien bis zum Schwarzen Meer vorgelegt. Sie richten den Blick über die Donauprovinzen hinaus nach Westen bis an den Oberrhein und nach Süden bis zum Zentralbalkan. Die Beispiele belegen die Bedeutung landschaftsarchäologischer Betrachtungen für die Rekonstruktion der mikro- und makroregionalen Einbindung einzelner Anlagen und zeigen, wie sich hieraus neue aufschlussreiche Hinweise bezüglich ihrer funktionalen Bedeutung ergeben.
Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur
Der Fundplatz Ödenkirche-Flur liegt ca. 1 km südlich der spätrömischen Befestigung von Keszthely-Fenékpusza. Die Ausgrabungen der letzten 100 Jahre legten neben den Überresten einer mittelalterlichen Kirche den zugehörigen Friedhof mit Bestattungen des 14. bis 17. Jahrhundert ebenso frei, wie die Gräber einer frühmittelalterlichen Nekropole des späten 6. und frühen 7. Jahrhunderts. In der vorliegenden Monographie werden die Gräber beider Zeitphasen publiziert. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen und die Bearbeitung der frühmittelalterlichen Perlenfunde sowie einige ausgewählte Metallfunde vorgelegt
Keszthely-Fenékpuszta: Katalog der Befunde und ausgewählter Funde sowie neue Forschungsergebnisse
Im Rahmen eines ungarisch-deutschen Kooperationsprojektes (2006-2009) wurden sämtliche römer- bis karolingerzeitliche Siedlungsbefunde des Fundplatzes von Keszthely-Fenékpuszta bearbeitet. In diesem Buch werden neben dem einschlägigen Katalog, Teile des zugehörigen Fundmaterials, Keramik-, Eisen- und Münzfunde vorgelegt. Im Weiteren werden die Ergebnisse der Ausgrabungen des Jahres 2009 veröffentlicht, die bereits eine Fortsetzung des oben erwähnten Projektes bildeten. Den Abschluss bilden Studien, die sich der Auswertung des archäobotanischen und archäozoologischen Materials des Siedlungsplatzes widmen.
Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta
Keszthely-Fenékpuszta zählt zu den wichtigsten Fundorten des spätantiken Pannonien, wo das Weiterleben römisch-frühchristlichen Traditionen seit dem 19. Jahrhundert historisch-archäologisch erforscht wird. Im Fokus der Untersuchungen stand dabei vor allem das südlich der spätrömischen Befestigung sich befindliche Bestattungsareal. In der vorliegenden Arbeit werden Funde und Befunde dieser sog. Südmauernekropole katalogisch erfasst und ausgewertet, die chronologisch vom 4. bis zum 9. Jahrhundert n. Chr. sich erstrecken. Die Studie trägt damit grundlegend der Diskurs über Kontinuitäten und Migrationen im westlichen Pannonien während der langen Spätantike bei.